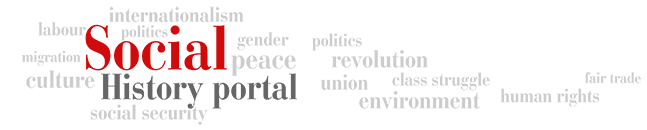| Summary: | Bemerkungen: [] = Absatzmarken im Volltext des Originals;
Weibliche Kriegsgefangene, I. [] (Siehe auch Sopade Nr. 274-276) [] I. Im Donezbergwerk [] Gefangennahme in Bukarest [] Als erste Münchner Heimkehrerin aus russischer Kriegsgefangenschaft ist Fräulein K., ehemalige Wehrmachthelferin, in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Fräulein K. ist heute 25 Jahre alt. Von Beruf war sie Sekretärin, als sie am 23. Dezember 1943 als Zivilangestellte zur Luftwaffe verpflichtet wurde. Am 24. August 1944 geriet sie in Bukarest in rumänische Gefangenschaft. Die Behandlung war gut und die Verpflegung ausreichend. Bald wurde das Lager den russischen Truppen übergeben. Verpflegung und Behandlung wurden schlechter, Vergewaltigungen waren alltäglich. Am 11. Januar 1945 wurde der Transport in Bukarest verladen. Volksdeutsche, Nachrichtenhelferinnen und reichsdeutsche Zivilangestellte im Alter zwischen 14 und 62 Jahren traten den Weg nach Rußland an. Drei Wochen dauerte der Transport in ungeheizten Güterwagen, in denen weder Stroh noch Decken zur Verfügung standen, Eiszapfen und Schnee ersetzten das Trinkwasser. Erst in der zweiten Woche gab es täglich einmal eine warme Suppe. Endstation war eine stillgelegte Kohlengrube im Donezgebiet in der Nähe von Krasjanka, wo 1200 Personen, Männer, Frauen und Kinder, das Lager 1209 bezogen. Auch hier noch zwei Monate ohne Decken und Strohsäcke in eiskalten Baracken. Jeder private Besitz von Wert, mitunter auch die Kleider, wurden abgenommen. Nach 14tägiger Quarantäne begann die Arbeit in der Kohlengrube. [] Nach zweimonatiger Arbeit gelähmt [] Fräulein K. wurde zur Nachtschicht im Schacht 12, der 6 Kilometer vom Lager entfernt war, eingeteilt, 385 Holzstufen mußten die Gefangenen hinabsteigen, um dann in nur 60 Zentimeter hohen Stollen, auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegend, Kohle zu verladen. Die normale Arbeitszeit betrug acht Stunden, doch immer mußten Ueberstunden gemacht werden, um die festgesetzte genormte Leistung zu erreichen. Die Arbeit war schwer und ungewohnt, aber Schläge und Fußtritte der Aufseher halfen manchmal nach. [] Nach zweimonatiger Arbeit - bis zu den Knien im kalten Wasser des Schachtes - wurde Fräulein K. an beiden Beinen gelähmt. Sie sollte in ein Erholungslager kommen, landete aber im April 1945 auf einer Kolchose, wo sie 16 Stunden täglich ohne Bezahlung arbeiten mußte. Da die Verpflegung auch hier wieder selbst bezahlt werden mußte, verkaufte sie ihre Decke für 250 Rubel. Für die 500 Gramm Brot und die zwei Portionen Suppe hatte sie täglich 3 bis 5 Rubel zu zahlen. Auf unübersehbaren Feldern mußte sie Kartoffeln hacken, die tägliche Arbeitsleistung war nach Kilometern festgelegt. Im Juni 1945 kam Fräulein K. in das Lager 1210, zwischen Krasjanka und Woroschilowgrad, in dem etwa 700 Menschen waren. Die Behandlung durch die Russen war dort gut, dafür waren die volksdeutschen Lagerführer um so brutaler. Nachdem Fräulein K. auf einem Bau als Ziegelträger gearbeitet hatte, erkrankte sie am 17. September 1945 an einer Kopfdrüsenvereiterung. Ohne Narkose wurde sie im Spital operiert. Als sie aus der Ohnmacht erwachte, sagte man ihr, sie solle ins Lager zurückgehen. Sieben Monate lag sie krank in ihrer Baracke. Obwohl wenig Verbandmaterial vorhanden war, wurden die Kranken von den russischen Aerzten ordentlich versorgt. Krankenbaracken und besondere Krankenkost gab es nicht. [] "Leichte Arbeit" [] Nach ihrer Genesung wurde Fräulein K. zu leichter Arbeit eingeteilt. In einem in der Nähe liegenden Lager, in dem aus Deutschland heimgekehrte Besatzungssoldaten und ehemalige Fremdarbeiter untergebracht waren, mußte sie diese bedienen. Immer für 60 Personen waren drei Mädchen eingeteilt. Die Behandlung war dort gut, doch im Juli 1946 mußte sie wieder zurück ins Bergwerk. 450 Meter unter der Erde hatte sie hier schwerste Arbeit zu leisten. Wenn sie die Kräfte verließen, schlugen Aufseher mit Knüppeln und Grubenlampen auf die Gefangenen ein. (Viele vernarbte Wunden, die uns Fräulein K. zeigte, beweisen ihre Aussage.) [] Schlimm war der Winter 1946/47. In Baracken, in denen nur selbstgebaute Oefen vorhanden waren, hausten sie mit einer Decke bei 45 bis 50 Grad Kälte. Heizmaterial gab es nicht, wenn nicht die Mädchen heimlich Kohle von der Schicht mitbrachten. Nach der in den Gruben geleisteten Arbeitszeit, die 10 bis 11 Stunden dauerte, mußten fast regelmäßig noch 2 bis 3 Stunden im Lager gearbeitet werden. Die Verpflegung war schlechter geworden. Die Preise aber stiegen erheblich. Schwarze Lebensmittel waren kaum mehr zu erstehen. Der höchste Monatslohn, den Fräulein K. ausgezahlt bekam, betrug 420 Rubel. Davon mußten 250 Rubel für die Kranken und für Steuern bezahlt werden, der Rest blieb für Verpflegung. Der Preis für 800 Gramm Brot auf Marken war von 80 Kopeken auf 3 Rubel gestiegen. Schwarz kostete ein Wecken (reichlich 2 Kilo) nun 160 bis 180 Rubel. [] Keine Post [] "Nie bekam ich Post", obwohl ich die ganzen Jahre regelmäßig nach Hause geschrieben hatte." (Diese Post kam nie an.) "Das war das Schlimmste", berichtet uns Fräulein K. "Wir verloren den Mut zum Leben, da wir unsere Angehörigen längst tot wähnten. Im März 1947 - ich arbeitete noch immer im Schacht - wog ich nur noch 80 Pfund. Bei meiner Gefangennahme hatte ich 153 Pfund. Da kamen eines Tages drei Karten von meinen Eltern. Ich wurde fast verrückt vor Freude. Nun hielt mich die Hoffnung aufrecht und am 11. Mai kam ich mit weiteren 148 aus unserem Lager zum Krankentransport. Mit 2500 Gramm Brot für fünf Tage traten wir den Weg in die Heimat an. Manche starben noch auf dem Transport. Auf der Fahrt durch Polen kamen bei jedem Halt Polen an den Zug, um uns Butter, Eier, Speck und Brot zu verkaufen. Manche brachen sich Goldzähne aus, um damit die Lebensmittel zu bezahlen. Bei der Ankunft in Frankfurt an der Oder wurden wir entlaust, registriert und sehr gut verpflegt. Dann ging's über das Lager Bebra nach Hammelburg bei Gemünden. Ueberall auf diesem Wege wurden wir ausgezeichnet verpflegt und hier erhielten wir auch erstmalig Zuwendungen des amerikanischen Roten Kreuzes. Von Hammelburg aus durfte ich allein weiterfahren." [] ("Süddeutsche Zeitung", München, 28. Juni 1947.) [] II. "Wir glaubten nicht an Wiedersehen" [] Völlig verschüchtert und mit schmalen, abgehärmten Gesichtern sind in diesen Tagen mit dem Kriegsgefangenentransport aus Rußland auch zwölf Frauen heimgekehrt, die von Friedland aus zu ihren Angehörigen in die englische und amerikanische Zone weitergeleitet werden. Drei von diesen ehemaligen Wehrmachthelferinnen und DRK-Schwestern sind so geschwächt, daß sie vorläufig an eine Weiterreise nicht denken können. Sie wurden in Göttinger Krankenhäusern untergebracht, wo die ärztliche Untersuchung ergab, daß sie einen schweren Herzfehler haben und an völliger Unterernährung leiden. [] Im Bett liegt die 27jährige Anni J. aus München-Gladbach [!]. An ihrer abgemagerten Gestalt fallen uns vor allem die Hände auf, die groß und breit, völlig ausgearbeitet von der harten Arbeit, die sie während zweieinhalb Jahre tun mußten, beredter Auskunft geben, als Worte das vermögen. [] "Haben Sie niemals einen freien Tag gehabt, wurde auch nie ein Fest gefeiert?", erkundigen wir uns behutsam. "Nein", ist die leise Antwort, "von einem Sonntag wußten wir nichts. Auch Weihnachten mußten wir genau wie an anderen Tagen arbeiten. Am 1. Mai hatten wir sogar zwei Schichten hintereinander, das ist dort immer so. Einmal in der Woche hatten wir wohl einen freien Tag, dann mußten wir aber in der Baracke arbeiten, auch draußen Steine klopfen, Bäume pflanzen und einen Friedhof anlegen. Arbeiten mußten wir immer, und wenn es damit nicht schnell genug ging, bekamen wir Schläge." [] "Zuerst haben wir wohl noch von daheim gesprochen, haben ein Lied gesungen, aber dann glaubten wir nicht mehr daran, daß wir Deutschland jemals wiedersehen würden." [] ("Hannoversche Neueste Nachrichten", Hannover, 14. Juni 1947.)
|
|---|