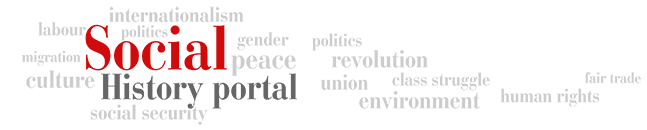| Summary: | Bemerkungen: [] = Absatzmarken im Volltext des Originals
Handelspoltische Flugblätter der "Nation" [] Nr. 8. [] Getreidezölle, Tuberkulose, Alkoholismus und Diebstahl. [] Das Brot im Arbeiter-Haushalt. [] In dem Flugblatt Nr. 5, das "Die Getreidezölle und das Jahresbudget einer Arbeiterfamilie" behandelt, ist dargelegt worden, daß die Brotnahrung für den Arbeiterhaushalt die allerhöchste Bedeutung besitzt. Es wurde dort unter Hinweis auf die Schrift des Herrn v. Scheel, des Direktors des reichsstatistischen Amtes, hervorgehoben, daß im Durchschnitt 1880-1898 in Deutschland pro Kopf 178,8 Kilo Brotgetreide für menschliche Ernährung gebraucht worden sind. Herr v. Scheel giebt aber auch den Durchschnitt dieses Verbrauchs für die letzten Jahre gesondert an, und da zeigt es sich, daß diese Jahresdurchschnitte beträchtlich höher sind als der Durchschnitt jenes achtzehnjährigen Zeitraums. Danach kommen auf den Kopf der Bevölkerung [...Tabelle...] [] Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre kommen daher auf den Kopf der deutschen Bevölkerung 193.60 kg. die zu Zwecken menschlicher Ernährung verbraucht werden. [] Da nun die Brotnahrung bei einer Einschränkung der Fleischnahrung verhältnißmäßig zunimmt, so ist der Getreidekonsum für die unteren Schichten der Bevölkerung höher anzusetzen als für die wohlhabenden Klassen. Man rechnet deshalb sehr vorsichtig, wenn man unter Zugrundelegung des fünfjährigen Durchschnitts von 193.60 kg, der für die Gesammtheit der Bevölkerung ermittelt ist, für die Arbeiterbevölkerung einen durchschnittlichen Jahreskonsum von rund 200 kg auf den Kopf annimmt. Von diesem Jahreskonsum von Brotgetreide kommt ein Theil als Backmehl und ein Theil als Speisemehl zum Verbrauch. Der Zoll von 3.50 M. für 100 kg Getreide verteuert dem Arbeiter diesen Konsum um 7 M. Eine Familie, die fünf Mitglieder zählt muß demnach für das notwendigste Nahrungsmittel im Jahre 35 M. mehr ausgeben, als es ohne diesen Zoll der Fall sein würde. Je kleiner das Einkommen, um so mehr wächst die Bedeutung dieser Belastung, die bei 900 M. Jahresverdienst schon circa 4 Proz. ausmacht. Wenn man bedenkt, daß zwei Drittel der Bevölkerung über ein Einkommen verfügen, das 900 M. im Jahr nicht übersteigt, so wird es offenbar, daß die Mehrheit der deutschen Bevölkerung schon von den gegenwärtigen Getreidezöllen schwer getroffen wird. Eine Zollerhöhung aber, die das Verlangen der Agrarier befriedigte, würde eine Abgabe von 75-100 M. vom jährlichen Brotverbrauch einer Arbeiterfamilie bedeuten und eine Steuer für die Armen und Aermsten darstellen, die schlechthin ungeheuerlich genannt werden müßte. [] Die Getreidezölle und der Nahrungsspielraum. [] Nach den Ausführungen, die im Flugblatt 6 gegeben sind, begünstigt jede Erhöhung des Getreidezolles die Ausbreitung des landwirthschaftlichen Großbetriebs auf Kosten des bäuerlichen Betriebs. Mit der Zunahme des Großgrundbesitzes verengert sich aber der Nahrungsspielraum der Bevölkerung, während er sich ihrem Wachsthum entsprechend erweitern sollte. In Gegenden, in welchem der Großgrundbesitz vorherrscht, ist die Bevölkerung weniger dicht als in Gegenden mit überwiegend bäuerlichen Wirtschaften. Die Auswanderung aus jenen Gegenden ist relativ stärker als aus diesen. Das zeigt sich am deutlichsten in Zeiten sehr hoher Getreidepreise. Im Jahre 1891, in welchem Jahre die Getreidepreise den höchsten Stand des letzten Jahrzehnts erreicht hatten, war auch die Auswanderungsziffer besonders hoch. Sie war am höchsten im dünnbesiedelten Osten, am niedrigsten im dichtbesiedelten Westen. Von 1000 Einwohnern wanderten 1891 aus der Provinz Posen 10,41, aus der Provinz Westpreußen 10,94, dagegen aus der Rheinprovinz nur 1,06 und aus Westfalen nur 0,93. In Posen kamen 1895 auf einen qkm 63.1, in Westpreußen 59,0, dagegen im Rheinland 181.4 und in Westfalen 133.5 Einwohner. [] In derselben Weise begünstigt die Ausbreitung des Großgrundbesitzes die Abwanderung der Landbevölkerung nach den Städten. Daraus erklärt sich die ländliche Arbeiternoth der östlichen Provinzen und darauf läßt sich zum großen Theil die lokale Uebervölkerung, an der unsere Großstädte leiden, zurückführen. Die Volksvermehrung ist hier nicht selten infolge der Zuwanderung aus den ländlichen Bezirken stärker, als die Vermehrung der Existenzbedingungen, welche die Stadt zu bieten vermag. Das sicherste Zeichen einer derartigen lokalen Uebervölkerung ist die Wohnungsnoth der ärmeren Klassen. Ihre Wohnungsverhältnisse gestalten sich immer ungünstiger. Eine immer größere Zahl von Personen sucht Obdach in derselben Wohnung. So kommt es, daß viele Arbeiter in ihren Wohnungen weniger Luftraum haben als die Sträflinge in den Gefängnissen. Infolge der intensiven Nachfrage steigen die Miethen und je mehr diese Volksklassen für Miethe ausgeben müssen, um so weniger bleibt ihnen für die Befriedigung ihrer Nahrungs- und Kleidungsbedürfnisse. Mangelhafte Nahrung und menschenunwürdige Wohnungen find aber auch die Hauptursachen des schlechteren Gesundheitszustandes und der höheren Sterblichkeit der unteren Klassen. [] Nach dem statistischen Jahrbuch der Stadt Berlin (1893) kamen im Jahre 1890/91 - dem Jahre der hohen Getreidepreise - auf 1000 Einwohner in fünf Bezirken des nördlichen Wedding durchschnittlich 37 Sterbefälle und in fünf Bezirken am Thiergarten und Unter den Linden 8,79 Sterbefälle. Das durchschnittliche Steuersoll betrug in jenen fünf Bezirken 2,80 M. auf den Kopf, in diesen dagegen 67,54 M. [] Indem die Getreidezölle die Ausbreitung des Großgrundbesitzes begünstigen, verengern sie den Nahrungsspielraum der Bevölkerung, und schon infolge dessen bedrohen sie die Existenzbedingungen der arbeitenden Klassen. [] Die Getreidezölle und der Alkoholismus. [] Infolge der Getreidezölle steigt der Preis des Grund und Bodens auf dem Lande und rückwirkend auch in den Städten und steigt der Preis des notwendigsten Nahrungsmittels. Mangelhafte Wohnung und mangelhafte Ernähruug tragen aber die Hauptschuld an der Ausbreitung des Alkoholismus. Es ist bekannt, daß schlechte Wohnungen den Wirthshausbesuch erhöhen. Die gleiche Wirkung hat eine mangelhafte Ernährung, die das Verlangen nach Branntweingenuß steigert. Alfred Grotjahn bemerkt darüber in seinem 1893 erschienenen Buche "Der Alkoholismus, nach Wesen, Wirkung und Verbreitung" folgendes: "Bei sinkender Volksernährung stellen sich Branntwein und Kaffee als regelmäßige Begleiter der Mahlzeiten ein. Der Schnaps wirkt hier um so deletärer, als er ja in unterernährten Organismen seine Wirksamkeit entfaltet und schlecht genährte Trinker ungleich schneller trunksüchtig werden als Personen, welche sich zugleich kräftig ernähren. Die Häufigkeit des Delirium tremens in den an chronischer Unterernährung laborirenden Distrikten Deutschlands (Schlesien, Posen, Westftreußen, gewisse Theile des Königreichs Sachsen) ist in erster Linie auf die enge Verbindung zurückzuführen, in der gewohnheitsmäßiges Branntweintrinken und die Unterernährung stehen." Schon zwanzig Jahre früher als Grotjahn hatte der Geheime Sanitätsrath Dr. A. Baer in seinem epochemachenden Werke über den Alkoholismus die Verbesserung der Volksernährung als eins der wirksamsten Mittel zur Bekämpfung des Alkoholismus empfohlen; denn auch er ist der Ansicht, daß die weite Verbreitung des regelmäßigen und übermäßigen Branntweintrinkens in den unteren Volksschichten hauptsächlich eine Folge der Unterernährung ist. Er sagt darüber folgendes: "Je armseliger, der Arbeiter sich nährt, desto größer sind die Anstrengungen, die er machen muß, um für eine bestimmte Arbeitsleistung den nöthigen Kraftaufwand zu ermöglichen. Je ungenügender die Nahrung an Menge und Beschaffenheit, um so größer der Mangel an Arbeitskraft. Unter solchen Verhältnissen spielt der Branntwein die Rolle des Wohlthäters, durch dessen häufige Wohlthaten der Körper bald seine ganze Arbeitsleistung einstellen muß. Der Branntwein ist nicht im Stande, wie ein geeignetes Nahrungsmittel, verausgabte Kräfte zu ersetzen und am allerwenigsten ohne schädliche Nebenwirkung und üble Folgen. Weil der Arbeiter die ausreichende Nahrung nicht hat, greift er zu dem trügerischen Alkohol, der ihn für den Augenblick über das Manko an Kraft hinweghilft. Jeöfter er aber zu dem Schnaps greift, desto weniger kann er von ihm lassen, er ist der Trunksucht früher oder später verfallen. Die Beschaffung einer guten Nahrung ist das beste Mittel, den Arbeiter vor den Gefahren des Alkoholismus zu schützen." Die Versorgung der arbeitenden Bevölkerung mit guten und billigen Nahrungsmitteln nennt Baer "eine dankenswerthe Aufgabe, die die Gesellschaft noch zu löfen hat. Durch sie würde die Physische Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Lebensdauer der arbeitenden Klaffen gesteigert und ein großer Theil der Trunksucht beseitigt, die aus Mangel an geeigneten Nahrungsmitteln entsteht." [] Weite Schichten der Bevölkerung leiden schon bei den gegenwärtigen Getreidepreisen an chronischer Unterernährung, die sie dem Leib und Seele zerstörenden Alkoholismus zuführt. Welche Verbreitung wird der Alkoholismus erst finden, wenn die Getreidezölle den Agrariern zu Liebe um das Doppelte erhöht sind! [] Die Getreidezölle und die Tuberkulose. [] Der niedere Ernährungszustand der unteren Volksschichten erklärt, ihre Empfänglichkeit für alle infektiösen Krankheiten und besonders die verderbliche Ausbreitung der Tuberkulose in Deutschland. In einem Artikel, den der ärztliche Statistiker der Gothaer Lebensversicherungsbank Dr. Gollmer in Nr. 41 des XVI. Jahrgangs der "Nation" veröffentlicht hat, wird die Schwindsucht als Volksseuche bezeichnet. Dr. Gollmer bemerkt, daß die Jahresberichte der Krankenversicherungsanstalten darin übereinstimmen, "daß es unter allen Erkrankungen eben die Lungentuberkulose war, auf deren Rechnung die allermeisten Krankheits- und Verpflegungstage und der bei weitem höchste Betrag an Arzt- bezw. Verpflegungskosten und an Sterbegeldern zu sehen sei. Und eben diese Krankheit war es, die von Jahr zu Jahr immer mehr, fast ausschließlich den Grund zu zahlreichen Invalidisirungen im relativ besten Mannesalter ergab." Auf Grund eines großen statistischen Materials konnte Dr. Gollmer dann auch zahlenmäßig nachweisen, daß die Lungenschwindsucht um so häufiger als Todesursache auftritt, je ungünstiger die allgemeine Vermögens- und Lebenslage sich gestaltet. Alle Mittel zur Bekämpfung dieser verheerenden Krankheit, die mit großem Aufwand jetzt in Bewegung gesetzt werden, können keinen entsprechenden Erfolg haben, solange es den unteren Volkschichten infolge hoher Getreidepreise nicht möglich ist, ihre Ernährungsbedürfnisse in ausreichender Weise zu befriedigen. Vor allem nöthig wäre auch, daß sie auf Sauberkeit um und am Menschen die nöthige Sorgfalt verwenden. "Die Bereitwilligkeit", sagt Dr. Gollmer, "zu diesem Zweck täglich wenn auch nur einige Pfennige zu opfern, kann jedoch keine allgemeine werden, wenn dieselben Kreise bei ihrem kärglichen Wirthschaftsetat schon Mühe und Sorge genug haben, die meist nur allzu zahlreichen Familienmitglieder nothdürftig zu sättigen. Deshalb ist von sämmtlichen Faktoren, die bei der Prophylaxe gegen die Lungenschwindsucht als Volksseuche in Betracht kommen ..., die Versorgung der wenig bemittelten und armen Volksmassen mit reichlichen, kräftigen und dabei billigen Ernährungsmitteln bei weitem der wichtigste. Und die Frage, wie sich eine solche Versorgung ermöglichen läßt, ist die dringendste Aufgabe, mit deren Lösung sich alle beschäftigen sollten, denen eine Hebung des Volkswohls durch Minderung der Tuberkulose am Herzen liegt." Diese Aufgabe wird jedenfalls in der Weise nicht gelöst, daß man mit der einen Hand Lungenheilstätten gründet und mit der andern Hand den Agrariern zu Liebe die wichtigsten Nahrungsmittel des Volkes durch Getreidezölle und Fleischeinfuhrverbote vertheuert. Welche Noth ist dringender, die der Getreideproduzenten oder die der von der Tuberkulose bedrohten und jährlich zu Tausenden durch sie um ihr Leben betrogenen Arbeiter? Jede Erhöhung der Getreidezölle bedeutet eine Verschlechterung der Ernährungsverhältnisse des deutschen Volkes und damit eine Vermehrung der Zahl derjenigen Personen, die der Tuberkulose zum Opfer fallen. [] Die Getreidezölle und die Kriminalität. [] In der Periode steigender Getreidepreise, als die Agrarier noch Freihändler waren, im Jahre 1867 hat der bekannte Statistiker Georg v. Mahr die Bewegung der bayrischen Kriminalität und die der Getreidepreise graphisch dargestellt und dazu folgendes bemerkt: "Ein Blick auf die graphischen Darstellungen zeigt sofort den genauesten Zusammenhang zwischen der Bewegung der Eigenthumsbeeinträchtigungen und dem Fallen und Steigen der Getreidepreise. Die Linien sind so überraschend parallel, daß man nicht anstehen kann zu bekennen, daß in der Periode 1835-61 so ziemlich jeder Sechser, um den das Getreide im Preise gestiegen ist, auf je 100000 Einwohner im Gebiete diesseits des Rheines einen Diebstahl mehr hervorgerufen hat, während andererseits das Fallen des Getreide-Preises um einen Sechser je einen Diebstahl bei der gleichen Zahl von Einwohnern verhütet hat." [] Da jene bayrische Statistik von ihrer Beweiskraft nichts eingebüßt hat, so will ich die von Mayr zusammengestellte Statistik hier wiedergeben: [...Tabelle...] [] Diese Statistik spricht mit einer solchen überzeugenden Deutlichkeit, daß man kein Wort der Erläuterung hinzuzufügen braucht. [] Alexander v. Oettingen bestätigt in seiner Moralstatistik das aus der bayrischen Statistik sich ergebende Resultat, indem er auch in der sächsischen Statistik eine Parallelität zwischen der Bewegung der Eigenthumsdelikte und der der Getreidepreise feststellt. [] Auch die preußische Kriminalstatistik, die bis zum Jahre 1878 geht, läßt den Kausalzusammenhang zwischen den Getreidepreisen und den Verbrechen mit derselben Deutlichkeit hervortreten. Im Jahre 1855 erreichte der Getreidepreis mit 14,21 M. für 50 kg Weizen und mit 11,45 M. für 50 kg Roggen den höchsten Stand in Preußen. Gleichzeitig steht die Kriminalziffer auf ihrem Höhepunkt. Dann fallen die Getreidepreise und im Jahre 1857 werden für 50 kg Weizen 10,18 M., für 50 kg Roggen 6,87 M. bezahlt. Gegenüber dem Jahr 1856 war ein Preissturz von 3-4 M. a 50 kg eingetreten. Dem entspricht ein Rückgang der Verbrechen gegen das Eigenthum von 81201 auf 56 310. Es folgt dann eine Periode niedriger Getreidepreise, in welcher auch die Kriminalität nachläßt und sich ziemlich gleich bleibt. Die Jahre 1867 und 1863 sind wieder Theuerungsjahre, wie sich aus folgenden Zahlen ergiebt: [...Tabelle...] [] Dementsprechend steigen die Vermögensdelikte von 60890 im Jahre 1866 auf 70 397 im Jahre 1867 und 1868 sogar auf 77199. Sobald der Getreidepreis eine gewisse Grenze überschreitet, hat er eine dauernde Steigerung der Kriminalität zur Folge. Im Jahre 1869 sinken die Preise für Weizen wieder auf 9.70 M. und für Roggen auf 8,08 M. und die Vermögensdelikte auf 67106. [] Der Geheime Ober-Justizrath Starke, der vortragender Rath im Justiz-Ministerium war, hatte im Jahre 1884 ein sehr bemerkenswerthes Buch über "Verbrechen und Verbrecher in Preußen 1854-1878" veröffentlicht. Auch er kommt auf Grund eingehender Untersuchungen zu dem Schluß, daß mit jeder Erhöhung der Getreidepreise auch die Kriminalität zunimmt. [] Die Krimmalstatistik des deutschen Reichs beginnt im Jahre 1882; auch sie läßt den Kausalzusammenhang zwischen Getreidepreis und Verbrechen deutlich bis in die neueste Zeit hinein erkennen. [] Die folgende Tabelle stellt die Roggenpreise der Zahl der wegen Diebstahls Verurtheilten gegenüber: [...Tabelle...] [] Die Parallelität der Bewegung zwischen Getreidepreis und Verbrechen zeigt sich auch hier. Nur ist zu beachten, daß ein Theil der Verbrecher nicht in dem Jahre, in welchem sie den Diebstahl begangen haben, sondern erst in dem folgenden Jahre verurtheilt wird. So kommt es, daß die höchste Zahl der Verurtheilten auf das Jahr 1892 fällt, welches dem Jahre der höchsten Getreidepreise folgt. Die Wirkungen der Preisschwankungen erstrecken sich außerdem immer noch auf das nächste Jahr und ergreifen den Brotpreis bekanntlich immer erst einige Zeit später. Auch ist bei der Vergleichung zu berücksichtigen, daß inzwischen die Bevölkerung beträchtlich gewachsen ist. [] Die im Vorstehenden mitgetheilten Thatsachen lassen klar erkennen, welche verderblichen Folgen jede Erhöhung der Getreidezölle auf die Gesundheit und Sittlichkeit des Volkes haben muß. Sie zeigen aber auch, daß die Lasten, welche der Getreidezoll dem deutschen Volke aufbürdet, weit schwerer sind, als in den Zollerträgen und den Preissteigerungen zum Ausdruck kommen; denn sobald der Gesundheitszustand sich verschlechtert, Armuth und Kriminalität zunehmen, müssen Gemeinden, Staat und Gesellschaft größere Mittel aufwenden, um die Kranken, Invaliden, Armen und Verbrecher zu erhalten. Dazu kommt dann noch die in Zahlen nicht abschätzbare Schädigung, die das ganze Volksleben durch die Erniedrigung der Lebenshaltung, die Verkümmerung der Arbeitskräfte und die Ausbreitung der Kriminalität erfährt. [] Wer angesichts dieser Thatsachen für eine Erhöhung der Getreidezölle eintritt, der übernimmt eine schwerwiegende Verantwortung für die Verschlechterung der Volksgesundheit und der Volksmoral. Jeder aber, dem Deutschlands Zukunft am Herzen liegt, hat die Pflicht, mit aller Kraft der Bewegung entgegenzutreten, die eine Vertheuerung der nochwendigsten Nahrungsmittel des Volkes anstrebt. [] Der Verlag der "Nation" (Georg Reimer, Berlin W., Lützowstraße 107/108) stellt dies Flugblatt weiteren Kreisen zum Preise von 10 Mark für die ersten 1000 Stück, zum Preise von 5 Mark für jedes weitere 1000 [] zur Verfügung. [] (100 Exemplare eines Flugblattes werden zu 1,50 Mark abgegeben. - Probeexemplare gratis.) [] Verlag von Georg Reimer, Berlin 77., Lützowstraße 107/109. -Druck von H. S. Hermann in Berlin.
|
|---|