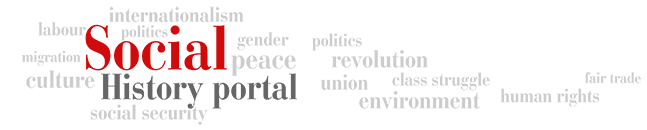| Summary: | Bemerkungen: [] = Absatzmarken im Volltext des Originals
Handelspolitische Flugblätter der "Nation." [] Nr. 3. [] Die Legende von der Schädigung der Landwirtschaft durch die Caprivi'sche Handelspolitik. [] Daß die Landwirtschaft durch die Caprivi'sche Handelspolitik schwer geschädigt worden sei, ist nach den Agrariern ein Axiom, und da man Axiome nicht zu beweisen braucht, so haben es die Gegner der Handelsverträge sehr bequem mit ihrer Behauptung; und auf diese wieder stützt sich die Forderung nach dem besseren Schutz der Landwirthschaft im neuen Zolltarif, d. h. nach gründlicher Erhöhung und Neueinführung von Zöllen auf landwirtschaftliche Produkte. [] In der That sind in den Handelsverträgen von 1892/94 die Zölle für Weizen und Roggen von 5 Mark auf 3,50 Mark, für Gerste von 2,25 Mark auf 2 Mark, für Hafer von 4 Mark auf 2,80 Mark herabgesetzt worden. [] Es hat dies nach den Behauptungen der Agrarier zu einer Ueberschwemmung Deutschlands mit Getreide und zu einem furchtbaren Preisdruck geführt. [] Sehen wir ganz davon ab, daß der Getreideproduzent kein geborenes Anrecht darauf hat, seinen Mitmenschen mit Hülfe des Staats für das wichtigste Lebensmittel mehr Geld abzunehmen, als dem natürlichen Marktpreis entspricht; sehen wir ganz davon ab, daß, als Bismarck 1887 die Erhöhung des Weizen- und Roggenzolls von 3 auf 5 Mark durchsetzte, er ausdrücklich erklärte, daß diese Erhöhung als Kompensationsobjekt bei künftigen Handelsvertragsverhandlungen dienen sollte, die Ermäßigung aber nur 1,50, nicht 2 Mark, ausgemacht hat; es soll zunächst nur untersucht werden, ob die obigen agrarischen Behauptungen richtig sind. [] An und für sich ist es für jeden denkenden Menschen selbstverständlich, daß kein Getreidehändler so thöricht sein wird, mehr Getreide einzuführen, als der Bedarf beträgt; das Getreide verliert durch Eintrocknen, Mäuse- und Insektenfraß erheblich an Gewicht; die Lagerspesen sind sehr beträchtlich und wachsen mit der Länge der Lagerzeit; schließlich ist der Verlust an Zinsen ebenfalls ein recht großer. Ueber den derzeitigen Bedarf wird ein Händler nur dann importiren, wenn er mit einer so stark steigenden Konjunktur rechnen kann, daß ihm in der Preissteigerung nicht nur reichlicher Ersatz für alle vorstehend aufgeführten Unkosten, sondern auch ein entsprechender Gewinn zu Theil wird. Eine Preissteigerung ist aber nur dann möglich, wenn die Waare knapp ist, d. h. wenn der Bedarf größer als das Angebot ist. Nur wenn sämmtliche Getreide-Importeure reif für Dalldorf wären, würden sie Getreide über den voraussichtlichen Bedarf hinaus importiren; die Leute wollen aber Geld verdienen, nicht verlieren. [] Wäre nun seit Abschluß der Handelsverträge die behauptete Ueberschwemmung mit ausländischem Getreide eingetreten, so müßten doch heut enorme Quantitäten über den Bedarf hinaus im Inland lagern; statt dessen haben wir nur normale - eher knappe als reichliche - Vorräthe, der beste Beweis, daß nur so viel, als der Bedarf erforderte, importirt worden ist. [] Aber auch relativ ist die Einfuhr zurückgegangen. [] Im Durchschnitt der 3 letzten Jahre vor den Handelsverträgen betrug der Ueberschuß der Einfuhr über die Ausfuhr bei Roggen 927 000 t in den Jahren 1897/99 dagegen nur 657 500 t, also rund 270 000 t weniger. Bei Weizen ist allerdings der Einfuhrüberschuß gleichzeitig von 693 000 t auf 1 174 000 t, also um 476 000 t gestiegen, zusammen sind also im Durchschnitt der letzten 3 Jahre 276 000 t Brotfrucht mehr eingeführt worden, als im Durchschnitt der 3 letzten Jahre vor Abschluß der Handelsverträge. Unsere Mehrausfuhr von Mehl, auf Getreide umgerechnet, ergiebt aber eine Steigerung von 100 000 t, sodaß tatsächlich nur eine Mehreinfuhr von 176 000 t Brotfrucht übrig bleibt, was gegenüber einer Bevölkerungszunahme von rund 6 Mill. Menschen ein entschiedener Rückgang der Einfuhr ist. [] Gewiß richtet sich die Einfuhr nach der Größe der heimischen Ernte; leider ist hier ein Vergleich nicht wohl möglich, da die Grundlagen der Ernteschätzung namentlich in früheren Jahren so stark hinter der Wirklichkeit zurückblieben, daß sie absolut vergleichsunfähig sind. Immerhin ist anzunehmen, daß der Getreideverbrauch auf den Kopf der Bevölkerung eine Erhöhung erfahren hat. Dieselbe kann im Interesse reichlicherer Ernährung der Bevölkerung nur freudig begrüßt werden. Zu einem sehr erheblichen Theil ist aber der vermehrte Getreideverbrauch auf die Zunahme des Viehstandes zurückzuführen; die von 1892-1897 bei Pferden 202 000, bei Rindvieh 935 000, bei Schweinen 2 100 000 betrug, während allerdings die Zahl der Schafe um 2,73 Mill. zurückging; letztere erhalten aber nur wenig Körnerfutter. Inzwischen hat sich die Zahl von Pferden, Rindvieh und Schweinen in Deutschland noch ganz außerordentlich vermehrt. Die Einfuhr von Schlachtvieh ist andererseits in Folge der Viehsperren außerordentlich zurückgegangen; so bei Rindvieh um 76 500 Häupter, bei Schweinen um 663 000 Stück in 1899 gegenüber 1891. [] Die vermehrte Viehzucht verlangt natürlich mehr Futtermittel: die deutsche Landwirthschaft ist gänzlich außer Stande ihren Bedarf an Futterstoffen selbst zu decken und wird dies um so weniger können, je mehr sie ihre Viehhaltung vergrößert. So war Deutschland, das in den 3 letzten Jahren vor Abschluß der Handelsverträge durchschnittlich jährlich 195 000 t Hafer einführte, genöthigt im Durchschnitt der 3 letzten Jahre trotz der riesigen 98er Haferernte 421 000 t jährlich einzuführen, im Durchschnitt der Jahre 1896-1893 sogar 500 000 t jährlich. Noch mehr ist die Einfuhr von Mais gestiegen nämlich von 395 000 t auf 1 492 000 t in dem gleichen Zeitraum, während der Import von Futtergerste sich von ca. 400 000 auf 700 000 t erhöhte, der von Kleie von 358 000 t auf 634 000 t, von Oelkuchen von 236 000 auf 460 000 t; in ähnlicher Weise ist die Einfuhr von Futtererbsen, Wicken, Lupinen, Futterbohnen, Mohn ec. gestiegen. Schließlich kommt der Landwirthschaft die vermehrte Einfuhr aller Oelfrüchte in den daraus erzeugten Oelkuchen zu Gute. Es giebt heut kaum einen Wirtschaftszweig, der derartig auf die Einfuhr angewiesen ist, wie die Landwirthschaft, speziell die Viehzucht. Diese ist aber der wichtigste Theil der Landwirthschaft, denn nach den vom deutschen Landwirthschaftsrath vorgenommenen Erhebungen zur Feststellung der Ergiebigkeit der Landwirtschaft entfallen von den Gesammteinnahmen aus dem Verkauf selbsterzeugter Produkte auf Getreide nur 26.4%, auf Vieh und Viehprodukte dagegen 40.6%. [] Der enormen Steigerung der Einfuhr von Futtermitteln um rund 2.5 Mill. t steht eine bedeutende relative Mindereinfuhr von Brotfrucht gegenüber, indem die ganze Zunahme 176 000 t beträgt. [] Allerdings hat auch die Einfuhr von Braugerste und Malz eine Vermehrung erfahren, die indessen nur einen kleinen Bruchtheil des Mehrverbrauchs der deutschen Brauereien in dieser Zeit ausmacht; die ganze Mehreinfuhr von Braugerste beträgt ca. 50 000 t p. a., von Malz 25 000 t im Durchschnitt der 3 letzten Jahre gegenüber den 3 Jahren vor den Handelsverträgen. [] Was für jeden denkenden Menschen selbstverständlich ist, daß durch die Zollherabsetzung keine Ueberschwemmnng mit ausländischem Getreide eintreten konnte, daß nicht mehr als der Bedarf importirt wurde, wird dann auch wie vorstehend dargelegt, durch die Ein- und Ausfuhrstatistik bestätigt. [] Hat denn nun die Zollherabsetzung zu einem so empfindlichen Preisdruck auf Getreide geführt? [] Derselbe könnte selbstverständlich nicht höher sein, als der Bettag, um den der Zoll herabgesetzt ist. [] Das ist bei Gerste 25 Pfg. für 100 kg, also so wenig, daß es überhaupt kaum in Betracht kommt, um so weniger als ein großer Theil der Gerstenernte in den eigenen Wirtschaften der Landwirthe verfüttert wird und 3/5 der Einfuhr ebenfalls aus Futtergerste besteht, an deren billigerem Bezug die Landwirthschaft selbst interessirt ist. Das Gleiche gilt vom Hafer, bei dem der Zoll von 4 auf 2.8 Mark herabgesetzt ist, aber hier hat die Zollherabsetzung nicht zu einer entsprechenden Preisherabsetzung geführt. Vor dem Jahr 1894 war eine Ausfuhr von Hafer aus Deutschland nicht möglich, da natürlich im Inland der Haferpreis infolge des hohen Zolls höher war, als der Weltmarktpreis; solche Gegenden, welche mehr Hafer bauen, als ihr Bedarf beträgt, mußten denselben auf große Entfernungen mit der theuren Bahnfracht nach den großen Konsumplätzen des Inlands bringen; um die Fracht verringerte sich der Preis am Produktionsort. Mit der erst nach dem russischen Handelsvertrag möglichen Aufhebung des Identitätsnachweises - die sich im Wesentlichen als eine Ansfuhrprämie in Höhe des Zolls darstellt - wurde es den Produzenten erst wieder möglich, mit ihrem Hafer den nächstgelegenen auswärtigen Markt - das natürliche Absatzgebiet aufzusuchen, was selbstverständlich eine Steigerung der Inlandspreise im Gefolge hatte. Es ist fast derselbe Vorgang wie bei Weizen und Roggen. [] Obgleich Deutschland nicht entfernt seinen Bedarf an Weizen baut, besteht doch zu Zeiten reicher Inlandsernten ein Ueberfluß an weicher, stärkehaltiger, viel Mehl gebender Maare, während an harter kleberreicher Maare ständig Mangel bei uns ist; letztere muß deshalb, um ein den Ansprüchen an Backfähigkeit entsprechendes Mehl zu erzielen, eingeführt und mit dem heimischen Produkt gemischt vermählen werden, oder man mich die verschiedenen Mehle mischen. Je kleberärmer der deutsche Weizen ist (und daß ist er in besonderem Maaße, wenn die Ernte verregnet, wie das 1894 im ganzen Süden und Westen der Fall war), um so mehr muß ausländische harte Maare eingeführt werden. Nach einer reichen Ernte herrscht in Deutschland Ueberfluß an weichem Weizen und namentlich der Osten sucht dann seinen Ueberschuß nach dem Westen abzustoßen; eine Ausfuhr war vor Aufhebung des Identitätsnachweises nicht möglich, da selbst bei dem größten Preisdruck der Inlandspreis infolge des hohen Zolls noch immer höher als der des Weltmarkts war. Eine reiche Weizenernte erfordert aber wegen des notwendigen Zumischens harten Weizens, eine umfangreiche Einfuhr davon, für die natürlich Weltmarktspreis plus Zoll gezahlt werden muß. Damals trat also der Fall ein, daß Inlandsernte zuzüglich Einfuhr den zeitweiligen Bedarf erheblich übertraf, was wiederum in einem starken Preisdruck für inländischen Weizen seinen Ausdruck fand, sodaß der Zoll im Preis nur verhältnißmäßig wenig zum Ausdruck kam, dem Produzenten also herzlich wenig nützte. So stand z. B. trotz eines Zolls von 30 bezw. 50 Mark Weizen in den Jahren 1885 bis 1888 in Berlin nur um 7.46 Mark, 5.86 Mark, 12.36 Mark und 22.17 Mark im Jahresdurchschnitt höher als in London, wobei zu bemerken ist, daß Fracht und Spesen nach Berlin für Weltmarktswaare um etwa 5 Mark höher sind, als nach London. [] Zu Zeiten ungünstiger Inlandsernten dagegen herrscht auch Knappheit an inländischer Waare; diese steigt entsprechend im Preise und der Zoll kommt in steigendem Maaße zum Ausdruck; so notirte Berlin in den Jahren 1889 bis 1891 im Jahresdurchschnitt um 48 M., 46.28 M. und 51.24 Mark höher als London. Die folgenden Jahre bringen gute Ernten und die Zollherabsetzung auf 35 Mark; die Spannung sinkt auf 34.59 Mark und 28.3 Mark im Jahresdurchschnitt der Jahre 1892 und 1893, ja bis auf 20.5 Mark im Mai 1894. Es geht hieraus also unwiderleglich hervor, daß vor Aufhebung des Identitätsnachweises nur in Zeiten quantitativ schlechter Ernten der Zoll zum Ausdruck kam, zu Zeiten reicher Inlandsernten aber es im Preise nicht sichtbar wurde, ob der Zoll 50 oder 35 Mark pro t betrug. [] Zu Zeiten knapper Inlandsernten nützt aber der großen Menge der Produzenten der Zoll nicht viel, da ihnen nach Abzug ihres Wirthschaftsbedarfs und des Saatguts wenig oder nichts zum Verkauf verbleibt. Um so stärker wird in solchen Zeiten der Konsument geschädigt, dem das dann ohnehin theure Brot noch um den vollen Zollbetrag vertheuert wird; ebenso der kleine Landwirth, der Getreide oder Brot zukaufen muß. [] Dieses Bild ändert sich vollständig mit der Aufhebung des Identitätsnachweises; die deutsche Waare kann wieder außerdeutsche Absatzgebiete aufsuchen, wo gerade an weichem, stark stärkehaltigem Weizen Mangel ist; sie hat nicht mehr nöthig, im Inland auf große Entfernungen abgesetzt zu werden und drückt nicht mehr im Westen und Süden auf den Preis; sie steigt auch bei reicher Ernte nahezu auf die Höhe des Weltmarktpreises zuzüglich Zoll; im Dezember 1894 notirt Berlin um 37.29 M. höher als London. [] Am klassischsten tritt dies Verhältniß in Danzig an den Preisen für unverzollte Transitwaare und Waare des freien Verkehrs zu Tage. Trotz des Kampfzolles von 75 Mark auf den dort allein als Transitwaare in Betracht kommenden russischen Weizen betrug die Spannung im Februar 1894 nur 17.33 Mark, also 57.17 Mark weniger als der Zoll, im Dezember desselben Jahres bei nur 35 Mark Zoll dagen 34.21 Mark, sie erreicht also fast den vollen Zoll. [] Das Verhältniß hat sich auch seitdem nicht wesentlich geändert; im Dezember 1899 betrug in Danzig die Spannung zwischen Inlands- und Auslandswaare 32.74 Mark; im Juli 1899 war sie dagegen 36.30 Mark. Die Schwankungen beruhen auf Qualitätsunterschieden. Wenn in manchen Gegenden der Unterschied größer ist, so liegt das daran, daß dort die Landwirthe vorziehen, zwar ertragreiche, aber qualitativ erheblich minderwerthige Weizensorten zu bauen. [] Ganz ähnlich ist das Verhältniß bei Roggen, der freilich nicht in dem Verhältniß Weltmarktswaare ist wie Weizen; auch sind die Unterschiede in der Backfähigkeit nicht ganz so groß; immerhin enthält die deutsche Waare erheblich weniger Kleber, als harter, glasiger, russischer Roggen. Auch hierbei zeigt sich, daß in den guten Erntejahren 1885 bis 1887 die Spannung zwischen unverzolltem russischen Roggen und Inlandswaare bei 30 Mark Zoll nur 20.27 Mark. 25.40 und 25.56 Mark betrug, bei 50 Mark Zoll bis auf 48.17 Mark in 1889 stieg, in 1892 sich nur noch auf 23.21 Mark belief, obgleich der Zoll für russische Provenienzen auf 50 Mark blieb, dagegen nach Aufhebung des Identitätsnachweises auf 34.08 Mark bei 35 Mark Zoll im Dezember 1894 stieg und sich bis in die letzte Zeit um 33 herum bewegt hat; wegen seines höheren Klebergehalts steht eben russischer Roggen verhältnißmäßig etwas höher im Preise als inländischer. [] Nach vorstehenden durchweg auf den Zahlen der amtlichen deutschen Reichsstatistik fußenden Ausführungen kann sich Niemand der Schlußfolgerung entziehen, daß [] erstens der frühere Zoll von 50 Mark von der 1892er Ernte ab nicht zu höheren Preisen geführt haben würde, als der 35 Mark-Zoll, sofern der Identitätsnachweis bei der Getreideausfuhr beibehalten wäre; [] zweitens, daß die erst durch den russischen Handelsvertrag möglich gewordene Aushebung des Identitätsnachweises eine wesentliche Preissteigerung des heimischen Produktes gegenüber den Weltmarktpreisen bewirkt hat; [] drittens, daß demnach die Handelsverträge, insbesondere der russische, für den deutschen Roggen- und Weizen-Produzenten, der mehr Getreide baut, als er selbst verbraucht, durchaus vorteilhaft gewirkt haben. [] Auch volle Zollautonomie und Erhöhung der Zölle würde in Jahren reicher Inlandsernte ohne die Ermöglichung der Ausfuhr durch die als Zollquittungen zu verwendenden Einfuhrscheine eine Steigerung der Preise nicht bewirken, in solchen knapper Ernten dagegen zu einer Theuerung führen, die alle Konsumenten auf das Schwerste bedrücken müßte. Die gleitende Skala endlich würde, weil mit dem System der Einfuhrscheine unvereinbar, den Export unmöglich machen und damit Produzenten und Handel gemeinsam schädigen. [] Wenn die Agrarier die preissteigernde Wirkung der Handelsverträge - speziell des russischen - der eben erst die Aufhebung des Identitätsnachweises ermöglicht hat, nicht zugestehen, so hat das zwei Ursachen: einmal würden sie damit zugeben, daß ihr Widerstand gegen den russischen Handelsvertrag selbst vom engsten agrarischen Interessenstandpunkt aus ein durchaus unberechtigter gewesen ist. Sodann aber können sie ihre Forderung, mittels der Zollschraube alle Konsumenten weiter zu schröpfen und ihre Taschen zu füllen, nicht besser, als mit der unwahren Behauptung begründen, daß sie durch die Handelsverträge geschädigt worden seien. [] Thatsächlich haben die letzteren der deutschen Landwirtschaft noch viel weiter genutzt, als in der Preiserhöhung für Brotfrucht und in der Erleichterung und Sicherung des Bezugs von Futter- und Düngemitteln. Sie haben, wie in dem Flugblatt I: "Die günstigen Wirkungen der Handelsverträge" nachgewiesen, der deutschen Industrie soviel Beschäftigung zu lohnenden Preisen verschafft, daß dadurch die Kaufkraft der breiten Schichten unserer Bevölkerung enorm gewachsen ist; dadurch sind der Landwirthschaft kaufkräftige Abnehmer der gewaltig gestiegenen Mehrerzeugung von thierischen Erzeugnissen - Milch, Butter, Käse, Fleisch, Geflügel, Wildbret ec. - erstanden. [] Nur dadurch, daß in einer voll beschäftigten Bevölkerung der heimischen Landwirthschaft kaufkräftige Konsumenten gegenüberstehen, vermag sie selbst zu gedeihen; ohne den Außenhandel können wir aber unsere Bevölkerung nicht beschäftigen; diesen durch Handelsverträge zu sichern ist demnach das wahre Interesse unserer Landwirthschaft. [] Der Verlag der "Nation" (Georg Reimer, Berlin W., Lützowstraße 107/108) stellt dies Flugblatt weiteren Kreisen zum Preise von 10 Mark für die ersten 1000 Stück, zum Preise von 5 Mark für jedes weitere 1000, zur Verfügung. [] Verlag von Georg Reimer, Berlin W., Lützuwstraße 107/108. - Druck von H. S. Hermann in Berlin.
|
|---|