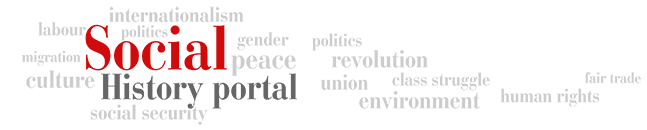| Summary: | Bemerkungen: [] = Absatzmarken im Volltext des Originals; [?] = vermutete Leseart
Handelspolitische Flugblätter der "Nation." [] Nr. 3. [] Die Schädigung der nationalen Arbeit durch Schutzzölle. [] Jedes Schutzzollsystem bezweckt, durch künstliche Preissteigerung der Produkte eines industriellen oder eines landwirthschaftlichen Gewerbes die Rentabilität der in diesem Gewerbe angelegten Kapitalien zu erhöhen. Man spricht dabei allerdings mit Vorliebe von einem Schutz der nationalen Arbeit; in Wirklichkeit handelt es sich stets um eine Begünstigung kapitalistischer Interessen auf Kosten der nationalen Arbeit. [] Eine Zeit lang hat man bei uns versucht, naiven Staatsbürgern begreiflich zu machen, daß das Ausland unsere Zölle bezahle. Thäte uns das Ausland diesen Gefallen, so würde es sich empfehlen, unsere Zölle fortgesetzt zu erhöhen, um die Zolleinnahmen entsprechend zu steigern und so nach und nach unsere gesammte Steuerlast auf das Ausland abzuwälzen. Das wäre gewiß für jeden inländischen Steuerzahler höchst erfreulich, aber denjenigen, die nach Schutzzöllen rufen, unseren Agrariern und unseren industriellen Protektionismen, wäre damit keineswegs gedient, denn wenn das Ausland die Zölle bezahlte, welche bei der Einfuhr ausländischer Waaren an unseren Grenzen erhoben werden, so könnten diese Zölle nicht die von den Schutzzöllnern angestrebte Wirkung ausüben, die Preise der gleichartigen inländischen Produkte zu erhöhen. Das wird nur geschehen, wenn nicht der ausländische Produzent, sondern der inländische Verbraucher die auf Produkte des Auslandes gelegten Zölle bezahlt. Nur dann wird der inländische Verbraucher dazu veranlaßt werden, statt der um die Zölle vertheuerten ausländischen Produkte gleichartige inländische Produkte zu kaufen, auf denen derartige Zölle nicht lasten. Er wird diese inländischen Produkte dann um einen Preis erwerben, der zwar den Weltmarktpreis übersteigt, aber doch etwas unter der Grenze liegt, die durch den Weltmarktpreis Plus Zoll bezeichnet wird. [] Kein Schutzzollsystem erreicht seinen Zweck, dem es nicht gelingt, [?] unter dem Einfluß von Schutzzöllen die Preise der inländischen Produkte über das natürliche Niveau der Weltmarktpreise zu heben. Das aber ist nur möglich, wenn die geschützten inländischen Produkte hinter dem Bedarf der inländischen Verbraucher zurückbleiben. Uebersteigt ihre Menge den inländischen Bedarf, so sorgt die inländische Konkurrenz schon dafür, daß die Preise das Preisniveau des Weltmarktes nicht überschreiten. Das sehen wir beispielsweise bei einem Artikel wie Rübenzucker, dessen Jahresproduktion noch nicht zur Hälfte in Deutschland selbst verbraucht wird, während der größere Theil ins Ausland exportirt wird. Der Produzent von deutschem Rübenzucker kann unter solchen Umständen selbst bei den höchsten Schutzzöllen nicht darauf rechnen, im Inland einen höheren Preis zu erzielen, als er für den ins Ausland versandten Zucker einschließlich der Exportprämie erhält. Schutzzölle sind in solchen Fällen wirkungslos, es sei denn, daß es den inländischen Produzenten gelingt, wie das ja bei vielen Artikeln und jetzt auch bei Rübenzucker gelungen ist, einen Produzentenring zu schaffen, der, hinter den Schutzzollmauern geborgen, trotz der den inländischen Bedarf weit übersteigenden Produktion die Preise für den inländischen Verbraucher höher stellt, als er die Preise für den ausländischen Verbraucher auf dem Weltmarkt stellen kann. Diese Begünstigung der Ringbildung zum Zwecke einer künstlichen Preissteigerung läßt sich jedoch nur als eine indirekte Wirkung der Schutzzölle bezeichnen. Die direkte Wirkung dagegen tritt dort ein, wo die inländische Produktion hinter dem inländischen Bedarf zurückbleibt, wo deshalb zur Deckung des inländischen Bedarfs auch gleichartige ausländische Waaren mit herangezogen werden müssen. Da diese ausländischen Waaren um den Einfuhrzoll vertheuert sind, und auf einem Markte gleichartige Waaren denselben Preis zu haben Pflegen, einerlei ob sie inländischen oder ausländischen Ursprungs sind, so muß der Preis des inländischen Produkts auf demselben inländischen Markte, wo auch die um den Zoll verteuerte ausländische Waare zum Verkauf kommt, im Preise ebenfalls bis zur Höhe des Zollsatzes künstlich gesteigert werden. Diese preissteigernde Wirkung, welche die Schutzzölle auf inländische Produkte der Industrie und der Landwirthschaft ausüben, ist Zweck und Ziel jedes Schutzzollsystems. [] Wir sehen heute bei dem wichtigsten Artikel des nationalen Bedarfs, bei dem Artikel Brotgetreide, daß die preissteigernde Wirkung des Schutzzolls von 35 Mark nahezu zum vollen eintritt. Wenn nicht immer kleine Qualitätsdifferenzen mit in Betracht kämen, so würde auf jedem inländischen Markte, wo inländisches und ausländisches Brotgetreide zusammenfließen, die künstliche Preissteigerung des inländischen Produkts um die vollen 35 Mark per Tonne eintreten. Wenn das, was die Agrarier angeblich anstreben, nämlich die Deckung des ganzen inländischen Bedarfs an Brotgetreide durch die inländische Produktion, jemals zur Wahrheit werden würde (in Wirklichkeit ist daran mit jedem Jahre weniger zu denken), so würde die künstliche Preissteigerung um die vollen 35 Mark per Tonne nicht mehr eintreten können. Es würde sich dann bei der Preisbildung für Getreide ein ähnliches Verhältniß herausstellen, wie es sich seit vielen Jahren für den inländischen Rübenzucker herausgestellt hat. In Wirklichkeit denkt denn auch kein ernsthafter Agrarier daran, einen Zustand herbeizuwünschen, welcher die Wirkung der von ihm erstrebten Getreidezölle beeinträchtigen und unter Umständen ganz hinfällig machen würde. Das fortgesetzte Wachsthum unserer Bevölkerung und die natürlichen Grenzen, die jeder landwirthschaftlichen Produktion in einem altkultivirten Lande gesteckt sind, lassen die Möglichkeit, daß jemals wieder der Bedarf an Brotgetreide in Deutschland durch die inländische Produktion allein gedeckt werden würde, übrigens als reine Träumerei erscheinen. [] Anders als bei den wichtigsten Produkten der Landwirthschaft liegt die Sache bei Produkten der Industrie. Industrieartikel können bei Aufwand von genügendem Kapital und Heranziehung von Arbeitskräften in der Regel der Menge nach in kurzer Zeit so gesteigert werden, daß auch der stärkste inländische Bedarf überschritten wird. Eine künstliche Preissteigerung, welche Industrieartikel ergreift, kann deshalb unter Umständen sehr rasch einen Industriezweig zur Entwicklung und dann zur Ueberproduktion bringen. In Industriezweigen, die eine derartige Entwicklung durchmachen, Pflegt die Preisentwicklung sich folgendermaßen zu voll [...] solange [?] der inländische Bedarf durch die inländische Produktion nicht gedeckt ist, wird unter dem Einfluß von Schutzzöllen die künstliche Preissteigerung bis zur Höhe des Schutzzolles getrieben, dann tritt unter dem Einfluß dieser künstlich erhöhten Preise eine forcirte Entwicklung des betreffenden Industriezweiges ein, eine allmähliche Steigerung der inländischen Produktion über den inländischen Bedarf hinaus, eine Verstärkung der inländischen Konkurrenz, eine Abschwächung und schließlich eine Wiederaufhebung der preissteigernden Wirkung der Schutzzölle; und endlich eine Ueberproduktion, hervorgerufen durch eine übermäßige Konkurrenz der unter dem Schutzzollsystem künstlich ins Leben gerufenen industriellen Unternehmungen. [] Bei all diesen verschiedenartigen Wirkungen der Schutzzölle ist aber stets das eine festzuhalten, daß keine der beabsichtigten preissteigernden Folgen des Protektionismus eintreten kann, ohne daß inländische Verbraucher geschädigt werden; und ferner ist daran festzuhalten, daß bei jeder Preissteigerung, die durch den Schutzzoll bewirkt wird, kein inländischer Produzent auch nur einen Pfennig mehr gewinnen kann, als inländische Verbraucher verlieren. Mit anderen Worten: Jedes Schutzzollsystem ist eine gesetzgeberische Veranstaltung, die inländische Verbraucher zwingt, aus dem Erträgniß ihrer wirtschaftlichen Thätigkeit Beträge herzugeben, die es ermöglichen sollen, daß andere Staatsbürger aus ihrem Eigenthum an Grund und Boden oder aus ihren Kapitalien eine höhere Rente beziehen, als das ohne die schutzzöllnerische Veranstaltung der Fall sein würde. Diese Abgabe der Konsumenten hat für den, der sie zahlt, genau dieselbe Bedeutung wie eine Steuer, die er entrichtet; nur mit dem Unterschied, daß er die Steuern dem Staat, der Allgemeinheit zahlt, während die durch Schutzzölle bewirkten Abgaben an inländische Produzenten, also an einzelne Staatsbürger, gehen. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß in dieser Parteinahme der Gesetzgebung für einzelne Klassen von Staatsbürgern die schwerste Ungerechtigkeit liegt. Man stelle sich nur einmal vor, daß jene mehr als 100 Millionen Mark, die heute allein den Produzenten von Getreide seitens der inländischen Broresser alljährlich bezahlt werden müssen, zunächst als Steuern an den Fiskus gingen, und dann vom Fiskus ohne jede Verschleierung in Baar den inländischen Getreideproduzenten je nach dem Umfang ihrer Produktion abgeliefert werden würden! Selbst der Bund der Landwirthe, der doch gewiß nicht an übermäßiger Bescheidenheit leidet, würde vor einer solchen Zumuthung Halt machen. In der verschleierten Form der Schutzzölle verlangt er dagegen, ohne zu erröthen, das Doppelte dieser Abgabe der Brotesser an die Getreideproduzenten. [] Das Geheimniß dafür, daß der Konsument, der durch eine schutzzöllnerische Gesetzgebung gezwungen wird, einen Theil seines Arbeitsertrages zur Aufbesserung der Kapital- und Grundrente anderer Staatsbürger herzugeben, gegen diese Besteuerung zu Gunsten dritter weniger entschieden aufzutreten pflegt als gegen die Zumuthung,ähnliche Beträge als Steuern an den Staat zu entrichten, liegt vornehmlich darin, daß die Schutzzollabgabe in dem Preise des Artikels, den der Konsument kauft, verborgen ist: der Konsument merkt es nicht! Damit trösten sich die Protektionisten selbst bei unerhörten Anforderungen an den Geldbeutel der Konsumenten. [] Für diejenigen Konsumenten, die es merken, hat man daneben eine Reihe von anderen Beschwichtigungsargumenten zur Verfügung. Mag immer, so führt man aus, der inländische Konsument dem inländischen Produzenten geschützter Waaren einen höheren Preis bezahlen, als das ohne Schutzzoll erforderlich wäre, er trägt auf diese Weise dazu bei, daß die geschützten industriellen oder landwirthschaftlichen Betriebe zur rascheren und volleren Entwickelung gelangen. Die eingefleischten Schutzzöllner suchen es gern so darzustellen, als ob ohne eine Begünstigung der inländischen Industrie durch Schutzzölle sich speziell in einem industriell noch wenig entwickelten Lande eine größere Industrie garnicht entwickeln werde, daß somit also der Konsument, indem er höhere Preise zahlt, zur Entwickelung der Industrie nicht bloß beiträgt, sondern diese Entwickelung der Industrie überhaupt erst möglich mache. [] Gegenüber den agrarischen Schutzzöllen lautet die Beweisführung nicht unwesentlich anders. Hier handelt es sich nach der schutzzöllnerischen Argumentation vorzugsweise um einen Schutz vor der Konkurrenz von Ackerbauländern, die noch jungfräulichen und deshalb besonders fruchtbaren und billigen Grund und Boden besitzen. Hier sollen also gewisse Vortheile, die die Natur anderer Länder bietet, durch die künstlichen Preise des Schutzzollsystems ausgeglichen werden. [] In allen Fällen, wo ein Schutzzoll zur Anwendung gelangt, geht der Schutzzöllner danach von der Voraussetzung aus, daß die geschützten inländischen Produkte entweder dauernd oder vorübergehend nicht ebenso wohlfeil auf den inländischen Markt gebracht werden können als die gleichartigen Produkte des Auslandes. Insofern nun der inländische Konsument durch Schutzzölle abgeschreckt wird, die ausländischen Produkte zu kaufen, und genöthigt wird, statt dessen inländische Produkte zu beziehen, die nicht so wohlfeil geliefert werden können als die ausländischen, geht regelmäßig ein Stück Nationalvermögen verloren. [] Könnte der inländische Produzent die Waare ebenso billig herstellen wie der ausländische, so würde das Nationalvermögen an sich nicht geschädigt werden, auch wenn der Konsument gezwungen wäre, unter der Einwirkung von Schutzzöllen dem inländischen Produzenten höhere Preise zu bezahlen, denn das, was er in diesem Falle mehr Produzenten wenigstens voll zu Gute kommen. Kann der Inländer aber nicht so billig Produziren wie der Ausländer, und wird der Konsument trotzdem gezwungen, die inländischen Produkte unter der preissteigernden Wirkung der Schutzzölle zu kaufen, so opfert der Konsument mehr als der inländische Produzent gewinnt. Die Differenz zwischen den Herstellungskosten im Inlande und denen im Auslande ist dann als reiner Verlust des Nationalvermögens abzubuchen. Dieser Verlust vermindert sich in demselben Maße, - wie die geschützte inländische Industrie leistungsfähiger wird. Ist sie dann ebenso leistungsfähig geworden wie die konkurrirende Industrie des Auslandes, so liegt in dem unter dem Einfluß des Schutzzolls künstlich gesteigerten Preise zwar kein direkter Verlust des Nationalvermögens vor, wohl aber eine Verschiebung des Nationalvermögens durch Ueberleitung dieses Mehrpreises aus den Taschen der Konsumenten in die der Produzenten. [] Der richtige Schutzzöllner Pflegt nun weiter zu behaupten, daß ohne die unter dem Schutzzollsystem erzwungenen künstlichen Preise gewisse Industrien in einem Lande überhaupt nicht aufgezogen werden könnten. Die Schutzzölle seien danach recht eigentlich Erziehungszölle, und wie man für die Erziehung der einzelnen Menschen aus allgemeinen Mitteln Aufwendungen mache, so dürfe man sich auch nicht scheuen, für die Erziehung von Industrien die Mittel der Allgemeinheit heranzuziehen. [] Dagegen ist Folgendes zu sagen: Gewiß kann man durch den künstlichen Dünger der Schutzzölle einzelne Industrien rascher zur Entwicklung bringen; daß sie ohne solche schutzzöllnerischen Mittel überhaupt nicht zur Entwicklung gelangen würden, dafür spricht aber weder die Logik noch die Erfahrung. Wir sehen, daß innerhalb der Grenzen eines einzelnen Landes, innerhalb dessen völliger Freihandel herrscht, fortgesetzt industrielle Unternehmungen neu ins Leben treten, obgleich sie die volle Konkurrenz von in anderen Theilen des Landes seit langer Zeit eingewurzelten Unternehmungen derselben Branche auszuhalten haben. Wenn das unter der Herrschaft des Freihandels in dem einzelnen Lande möglich ist, so ist der Schluß unabweisbar, daß es gegenüber der Konkurrenz des Auslandes, die schon wegen der größeren Entfernungen in der Regel geringer ist, auch möglich sein muß. [] Zur Erläuterung diene nur ein Beispiel: Innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten von Amerika, die ein Gebiet so groß wie ganz Europa umfassen, herrscht völliger Freihandel. Auf diesem Gebiet entwickelte sich in Pennsylvanien eine gewaltige Eisenindustrie. Nachdem diese Eisenindustrie schon außerordentlich erstarkt war, bildete sich in dem bis dahin industriell gänzlich unentwickelten Süden ein neues Centrum der Eisenindustrie. Trotz des Freihandels innerhalb der Vereinigten Staaten ist dann die Eisenindustrie von Alabama allmählich dermaßen erstarkt, daß sie heute nicht bloß auf dem amerikanischen Markte mit der älteren Rivalin in Pennsylvanien zu konkurriren vermag, sondern auch im Stande ist, auf den Märkten der Welt den Kampf mit der englischen Eisenindustrie aufzunehmen. Wäre es in den sechziger Jahren zu einer Trennung der Vereinigten Staaten in einen Norden und in einen Süden gekommen, so würden die Schutzzöllner von Alabama ganz gewiß die Behauptung aufgestellt haben, daß es ihnen niemals möglich sein würde, gegenüber der Konkurrenz der Pennsylvanischen Eisenindustrie in die Höhe zu kommen, wenn sie dieser Industrie gegenüber nicht durch die höchsten Schutzzölle gedeckt seien. [] Auch bei uns in Deutschland sind gerade viele der leistungsfähigsten Industrien ohne jeden Schutzzoll oder unter dem Schütze von kaum in Betracht zu ziehenden Zöllen in die Höhe gekommen und so erstarkt, daß sie die freie Weltkonkurrenz auszuhalten vermögen. Man denke nur an die Cementindustrie, die Bierbrauerei, die Farbenindustrie, die Feinmechanik, die Elektrizitätsindustrie, die Fahrradindustrie, die Schiffbauindustrie. [] Je weniger man den Beweis zu führen vermag, daß nur hinter der Mauer von Schutzzöllen Industrien groß werden können, um so vorsichtiger sollte man danach auch bei der Anwendung von sogenannten Erziehungszöllen sein. Die Erfahrung lehrt ferner, daß auch diejenigen Zölle, die ursprünglich als Erziehungszölle oder als Schutz gegen Krisen, somit ihrer Natur nach als vorübergehende Zölle gedacht waren, von den Schutzzollinteressenten auch dann festgehalten werden, wenn die Erziehung oder die Krisis längst vorüber ist. [] Festzuhalten ist dabei immer, daß die Opfer, die zur Entwicklung des einen Arbeitszweiges gebracht werden, anderen inländischen Arbeitszweigen zum Schaden gereichen müssen. Selbst da, wo es sich um einen wirklichen Erziehungszoll handelt, nimmt man die Mittel, die von Produktiveren Arbeitszweigen gewonnen sind, um sie zur Erhöhung der Rente in weniger produktiven Arbeitszweigen zu verwenden. Der schutzzöllnerische Einwand, daß derartige Aufwendungen sich schließlich wieder dadurch bezahlt machten, daß auf den neuen Arbeitsgebieten neue Arbeitskräfte Arbeit und Verdienst fänden, ist hinfällig, da bei jeder gesunden volkswirthschaftlichen Entwicklung die Frage nicht so steht: Arbeit oder nicht, sondern: Arbeit in diesem oder jenem Produktionszweige. Die künstliche Entwicklung der Industrie durch Schutzzölle hat deshalb für die Arbeiter im wesentlichen nur die Bedeutung, daß sie aus Arbeitszweigen, die sich ohne künstliche Mittel entwickelt haben, hinweggelockt werden, um in anderen Produktionszweigen, die durch künstliche Mittel einer forcirten Entwicklung zugeführt werden, Arbeit zu finden. Allerdings kann dadurch auf dem inländischen Arbeitsmarkt eine Konjunktur geschaffen werden, welche die Arbeitslöhne vorübergehend zum Steigen bringt, aber da die gestiegenen Arbeitslöhne aus keiner natürlichen sondern aus einer künstlich geschaffenen Nachfrage erwachsen sind, so treten sie regelmäßig in erhöhten Preisen der Arbeitsprodukte wieder zu Tage, so daß selbst diejenigen Arbeiter, welche vorübergehend als Lohnempfänger Prositiren, stets wieder einen großen Theil dessen einbüßen, was sie in der künstlichen Konjunktur an höheren Löhnen errungen haben. [] Für die Lohnarbeiter im Allgemeinen kann es niemals ein Vortheil sein, wenn die gesammte nationale Arbeit weniger produktiv wird, und noch weniger kann es ihr Vortheil sein, wenn durch Veranstaltungen der Gesetzgebung die Kapitalrente und die Grundrente künstlich gesteigert werden. Diese Steigerung erfolgt stets zu Lasten des Lohnfonds. Mit anderen Worten: Jedes Schutzzollsystem hat die Tendenz, nationale Arbeit von einer produktiveren Thätigkeit zu einer weniger produktiven überzuleiten, und ferner bei der Verkeilung des Gesamtprodukts der nationalen Arbeit das Kapital und die Grundrente zu begünstigen und die Arbeit zu benachtheiligen. Man mag den Schutzzöllen eine Form und einen Namen geben, wie immer man will, diese beiden Wirkungen sind mit jedem Schutzzollsystem unerläßlich verknüpft. Deshalb muß jeder Arbeiter, der seine Interessen versteht, ein Gegner der Schutzzölle sein. [] Der Verlag der "Nation" (Georg Reimer, Berlin W., Lützowstraße 107/108) stellt dies Flugblatt weiteren Kreisen zum Preise von 10 Mark für die ersten 1000 Stück, zum Preise von 5 Mark für jedes weitere 1000, zur Verfügung. [] Verlag von Georg Reimer, Berlin W., Lützowstraße 107/108. - Druck von H. S. Hermann in Berlin.
|
|---|